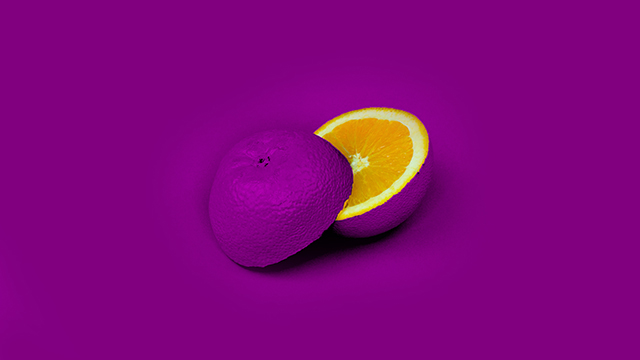"Du sollst fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat." Deuteronomium 26,11 (Monatsspruch Februar)
Letztens las ich in einem Zeitungsartikel: "Es ist schwierig, derzeit ein Optimist zu sein."
Und in der Tat, wir sind aktuell umgeben von Krisen und Problemen, in unserem Land, in Europa und auf der Welt. Die Klimakrise ist aktueller denn je, wenn auch viele Regierungen weltweit meinen, bei ihrer Bewältigung eine Pause einlegen zu können. Kriege wie in der Ukraine oder Palästina erschüttern Europa und die Welt und lassen die Menschen neben all dem Leid und der Not der Opfer ratlos zurück. In Deutschland merken viele, dass wir ohne Reformen und schmerzhafte Einschnitte wohl nicht auskommen werden. Und bei all dem, was von außen auf uns einprasselt, ist das, was uns persönlich und familiär zu schaffen macht, noch gar nicht miteingerechnet.
Es ist wahrlich schwierig, zur Zeit ein Optimist zu sein!
Unser Monatsspruch aus dem Buch Deuteronomium im Alten Testament (5. Buch Mose) schlägt einen anderen Ton an. Er ruft zur Fröhlichkeit und Dankbarkeit gegenüber Gott auf. Er stammt aus der Abschiedsrede des Moses, bevor das aus Ägypten befreite Volk Israel über den Fluss Jordan ins gelobte Land ziehen wird. Sein inhaltlicher Hintergrund ist der Dank für die Erntegaben. Dieser Vers ruft uns dazu auf, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, unseren Blick weg vom Negativen auf das Positive um uns herum zu richten, ohne das Schwierige und Problematische zu verdrängen. Wer nur noch schlimme Nachrichten wahrnimmt, kommt aus der Spirale, die uns nach unten zieht, nicht mehr heraus.
Um aus diesem Sog herauszufinden, hat Holger Meyer in seiner Auslegung unseres Monatsspruchs angeregt, ein Tagebuch des Guten und Schönen in unserem Leben anzulegen. So entstehe eine wunderbare Sammlung, die dankbar werden ließe und uns hoffentlich in schwierigen Phasen des Lebens stärken könne.
Ich halte das für eine schöne Idee, zumal zu Anfang des Jahres. So kann eine gewisse Vorfreude auf das entstehen, was unser Vater im Himmel Positives in 2026 für uns bereithält. Holger Meyer lässt seine Gedanken in folgendes Gebet mit einfließen:
"Barmherziger Gott, ich freue mich schon auf all das, was du Gutes für mich bereithältst und worauf ich am Ende des Jahres dankbar zurückblicken kann. Schenke mir den Blick für all das Gute und Schöne in meinem Leben, damit die schweren und belastenden Nachrichten mich nicht erdrücken. Du meinst es gut mit mir. Davon will ich erzählen. Danke!"
Pfarrer Joachim Schuler